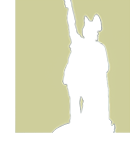Sie sind gerade im Bereich Home - Beiträge - nach der römischen Okkupation - Vorwort Hethis - Kloster Corvey und seine Erstgründung auf dem Tönsberg bei Oerlinghausen - Ein Bilderbogen mit geometrischer Projektskizze
Hethis, Kloster Corvey und seine Erstgründung auf dem Tönsberg bei Oerlinghausen
Enttarnung des frühkarolingischen Hallenbaue als ein Abbild des „Himmlischen Jerusalem“
Ein Bilderbogen mit geometrischer Projektskizz vorgelegt vo Bernd Rehfuß, Unna 2025
Vorwort
Ja, wie fängt man so eine Geschichte an, wenn man vor einem leeren Blatt sitzt? Wo es so viel mitzuteilen gibt und man versucht ist, auch die Hintergründe ausreichend zu beleuchten. Kurz und knapp hätte ich auch nur ein paar Skizzen anbieten können, aber dann wäre der Zusammenhang nicht mehr verständlich.
Vielleicht erleichtert uns hier ein Zitat den Einstieg etwas: „Man soll öfters dasjenige untersuchen, was von den Menschen meist vergessen wird, wo sie nicht hinsehen, und was so sehr als bekannt angenommen wird, dass es keiner Untersuchung mehr wert geachtet wird.“ (Georg Christoph Lichtenberg, Physiker, Mathematiker, Professor, 1742-1799) Am Anfang dachte ich noch, mit diversen Zeichnungen hätte man das Thema schnell abgearbeitet. Weit gefehlt. Insgesamt sind es nun, mit Unterbrechungen, 5 Jahre geworden, in denen ich, sagen wir einmal, an diesem „zusammengestoppelten Bilderbogen“ recherchiert und gearbeitet habe. Und nichts anderes soll es sein. Ein Bilderbogen. Es ist mir auch völlig klar, dass Kritiker meinen „Skript“ zu verreißen suchen und die zahlrechen Skizzen als „hochkomplexen Wirrwarr geometrischer Zeichenspielereien“ bezeichnen werden. Das kann der Kernaussage in keinem Fall schaden. Alles ist im Grunde ganz einfach! Wenn man den Schlüssel hat, öffnet sich die Tür. Sonst eben nicht. Mag sein, dass manches auf den ersten Blick etwas aufgebläht erscheint. Was bestimmte Althistoriker (z.B. Nicolaus Schaten und Johannes Letzner) betrifft, so war es mir sehr wichtig, die Hintergründe zu erläutern, um deren Glaubwürdigkeit zu untermauern. Dem interessierten Leser wird hier also eine kleine Zeitreise angeboten, und wir kommen auch an der römischen Zeit nicht vorbei. Diesen Zusammenhang möchte ich versuchen darzustellen. Mit meinem „Sammelsurium von gesammelten Textbausteinen“ –um Kritikern gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen- möchte ich einen Bogen spannen, der für unsere Geschichte von fundamentaler Bedeutung ist. Mit meinem Skript verfolge ich keinerlei gewerbliche Absichten. Er soll einzig und allein der Informationsvermittlung dienen und nachdenklich machen. Ich war bemüht, meine Quellen immer direkt im Umfeld eines Textbeitrages zu nennen. Sollte sie irgendwo fehlen, bzw. sich jemand übergangen fühlen, dann bitte ich um Entschuldigung und um Information, um diesen Fehler zu korrigieren.
Meine Skizzen sind alle „handbelassen“, nicht mit dem PC schön geschliffen. Erstens fehlen mir dazu die Kenntnisse, zweitens die Zeit und drittens würde es dadurch auch nicht genauer. Damit sich die „trockene Materie“ trotzdem einigermaßen leicht lesen lässt, habe ich versucht, den Stoff auch durch Einfügen vieler Fotos und Abbildungen etwas aufzulockern. Aber worum geht es überhaupt? Es geht um den sog. „Karolingischen Hallenbau“ auf dem Tönsberg bei Oerlinghausen. Viele Jahre bin ich von 2004 an bis heute mit dem Römerforscher und Buchautor Dr. Manfred Millhoff im Lippischen Wald unterwegs gewesen. 2024 haben wir unser erstes gemeinsames Buch zur sog. „Varusschlacht“ veröffentlicht (Auszüge im Skript). Dachte ich zuerst, die Hünenkapelle im Kernwerk des Tönsberges wäre die interessanteste Stelle, so richtete sich mein Interesse mehr und mehr auf die Fundamentreste des Hallenbaues und ich fragte mich, warum die Wissenschaft dieses Rätsel bis heute nicht lösen konnte. Der Archäologe Friedrich Hohenschwert konnte in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bei seinen Ausgrabungen nicht ahnen, welches Juwel er da untersucht hat. 30 Jahre später war ich erstmalig dort und 50 Jahre später löste ich das Rätsel auf. Im Jahre 2005 fanden dort auch geophysikalische Messungen (Geo-Elektrik) statt. Im Gegensatz zu meinem Partner, Dr. Manfred Millhoff, konnte ich damals aus beruflichen Gründen leider nicht dabei sein. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen (Abb. im Skript). Unter den karolingischen Fundamenten soll sich nach Aussage der Experten ein sächsischer Vorgängerbau abzeichnen. Als ich das erfuhr, war mir eigentlich schon damals klar, um was es sich beim Hallenbau handelte. Und jetzt verstand ich auch, warum sich mein Partner so sehr für das Thema „Hethis“ interessierte. Er suchte gar nicht „Hethis“, sondern ein bedeutendes sächsisches oder germanisches Heiligtum. Weil er aus einem Buch von Walther Matthes wusste, dass die Örtlichkeit „Hethis“ zwingend einen heidnischen Kultplatz erforderte. Genauso, wie die „Varusschlacht“ ein Hauptheiligtum erforderte. Das war also der Beweggrund. Wahrscheinlich handelt es sich um ein und dasselbe Heiligtum, nur aus zwei völlig verschiedenen Denkansätzen her eingekreist. Und so viele Hauptheiligtümer kann es in dieser Gegend nicht gegeben haben. Nicolaus Schaten berichtet uns, die „Varusschlacht“ sei ungefähr dort gewesen, wo im Jahre 783 die Feldschlacht zwischen Karl dem Großen und den Sachsen bei „Theotmalli“ war. Wir kommen also nicht daran vorbei, im Skript auch auf die Römerzeit einzugehen. Nach den o.a. Messungen im Jahre 2005 hat es am Hallenbau m.W. keine weiteren zielführenden Untersuchungen mehr gegeben. Soll es das jetzt gewesen sein?
Nein. Ich bin mir sicher, dass nach Studium dieser „Lektüre“ auch jeder, der alles vom Tönsberg zu wissen glaubt, am Ende an einem Achselzucken nicht vorbeikommt. Es geht aber im wesentlichen um die Erstgründung des Klosters Corvey bei Höxter an der Weser. Diese Erstgründung hatte den Namen „Hethis“, besser und richtiger überliefert: „Hetha“. Im Jahre 815 gegründet, wurde es 822 aufgegeben und die Mönche (Benediktiner) zogen nach Höxter um.
Ich verspürte den Wunsch, die Historie hierzu etwas aufzuarbeiten. Dieses Rätsel zu lösen und den Schleier der Vergangenheit zu lüften, trieb mich an. Leider, und das sagen alle Quellen, gibt es im Gegensatz zu anderen Höhenburgen so gut wie keine Informationen, so als wenn man die Vergangenheit bewusst gelöscht hätte. Dafür gibt es den Begriff der „Damnatio Memoriae“, die bewusste Tilgung von Erinnerungen. Die Neugier auf dieses Projekt war geweckt und der Anspruch war hoch, aber ich dachte mir, es könne nicht schaden, es einmal „ingenieurmäßig“ anzugehen. Kloster „Hethis“ wurde nachweislich an der Stelle eines altsächsischen Hauptheiligtumes gegründet. Und christliche Kirchen wurden im Frühmittelalter i.d.R. über heidnischen Kultplätzen errichtet. Fazit: Wer „Hethis/Hetha“ glaubt irgendwo verorten zu können, der muss zwingend an selber Stelle einen heidnischen Hauptkultplatz anbieten können.
Am Tönsberg können wir das, wie wir noch sehen werden. Sicherlich, man kann versuchen über frühe Ortsnamen einen etymologischen Bezug herzustellen. Aber hier haben wir es mit realistischen Fundamentresten und archäologisch nachgewiesenen Maßangaben zu tun….!
Und das ist jetzt endlich die Stelle, an der ich mich kurz vorstellen sollte: Mein Name ist Bernd Rehfuß, geboren am 15.5.1958 in Unna, Studien der Energie-Versorgungstechnik und der Betriebswirtschaft. Als Dipl.-Ing. viele Jahre in namhaften Industrieunternehmen tätig. Ab 1995 eigenes Ingenieurbüro in Unna. Schwerpunkt: Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung. All die Jahre wurden mir Grundrisse für meine weitere Planungsarbeit zugeschickt. Jetzt sollten mir meine Kenntnisse, Grundrisse zu beurteilen zu Gute kommen. Man muss auch nicht Kunstgeschichte studiert haben. Allein das Gefühl für die Qualität des Ortes zeigt einem den Weg. In der ganzen Zeit, in der ich als Hobbyarchäologe oder als Hobbyhistoriker tätig war, arbeitete ich „interdisziplinär“. Ich ging auch andere Wege und versuchte – eigentlich zwingend erforderlich und logisch- sich in die Denkweise früherer Kulturen hineinzuversetzen. Wer das nicht tut, und auch nicht bereit ist, Geomantie zu akzeptieren, der marschiert immer in denselben Wegen anderer und kommt immer da an, wo andere auch schon –ergebnislos- angekommen sind. Da ich kein Architekt oder Kunsthistoriker bin, habe ich in Ermangelung eigener Kenntnisse versucht, viele Beispiele beizubringen, um an Sicherheit zu gewinnen. Wenn man also in der Lage ist, den „Tempel des Salomo“ auf einem Bierdeckel zu zeichnen und zu berechnen, dann wird es schwer, dagegen zu argumentieren. Solange also niemand eine bessere Örtlichkeit anbieten kann, und dazu Fundamentreste beibringt, die zudem der Zahlensymbolik des „Himmlischen Jerusalem“ entsprechen, solange behaupte ich, ist „Hethis“ auf dem Tönsberg gegründet worden. Vom Papstbesuch im Jahre 799 an hat es 1225 Jahre gedauert, bis der „Tempel des Salomo“ wiederentdeckt wurde.Eigentlich muss man nur 1 + 1 zusammenzählen und etwas im Methoden-Mix forschen.
Zu diesem Mix gehört auch die Luftbildarchäologie, die wenn eben möglich, immer wieder herangezogen wurde. Leider ist unsere Stelle am Tönsberg so gut wie immer bewaldet gewesen, so dass hier „Schummerungsbilder“ ausreichen müssen. Diese sind jedoch sehr deutlich auszumachen und die Ausbruchgräben sind unübersehbar. Ich erinnerte mich an das Buch von Rudolf Pörtner „Die Erben Roms“ und insbesondere an die Rezension der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: „Er (Pörtner) setzt um, was die Wissenschaft weder tut, noch will und vermag“ und der Hessische Rundfunk titelt: „So wird Geschichte wieder manierlich, so lässt sie sich anschauen und begreifen. Dieses Buch ist ein Paradebeispiel dafür, wie die Historie Leben und Bezug auf unsere Zeit gewinnen kann“. Vielleicht gelingt es, wenigstens einen Bruchteil davon mit diesem Skript zu erreichen.
Bis zum Jahre 1548 haben nachweislich Wallfahrten zu Pfingsten von Dortmund ausgehend stattgefunden. Ironie der Geschichte: Tatsächlich ist mein Nachname bereits ab dem Jahr 1431 urkundlich in Dortmund nachgewiesen (siehe Skript). Von meinem Vater, Werner Rehfuß, erbte ich seine ganzen historischen Hinterlassenschaften mit z.T. völlig vergilbten Zeitungsartikeln aus Dortmund, die belegen, dass meine Vorfahren in Dortmund einen Weinhandel und eine Herberge in unmittelbarer Nähe zur berühmten „Reinoldi-Kirche“ betrieben. Jetzt verstand ich, warum ich immer irgendeine Verbindung zum Tönsberg verspürte. Bestimmt waren meine Vorfahren im 16. Jahrhundert bereits hier gewesen, oder wenn nicht, dann sind die Wallfahrer nach ihrer Rückkehr in Dortmund bestimmt in unserer Herberge oder in der Weinstube eingekehrt.
Ich spreche bereits an dieser Stelle allen Autoren, die mit Ihren individuellen Fachbeiträgen dazu beigetragen haben, dass ich in Kombination aller einen gemeinsamen Hauptnenner gefunden habe. Und dieser führt uns unweigerlich in den Lippischen Wald. Jeder für sich hat ein Mosaiksteinchen in der ganzen Indizienkette beigebracht.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sei folgenden Autoren recht herzlich dafür gedankt: Walther Matthes, Manfred Millhoff, Gerhard Steinborn, Peter Johanek, Birgit Meineke, Axel Hausmann, Beate Weifenbach, Herbert Knörich, Hedwig Röckelein, Horst Braukmann, Josef Koch, Leopold Möller, Roland Linde, Karl Banghard, Hans Kiewning, Judith Zepp, Brigitte Kasten, Roman Mensing, Rudolf Becker, Karl Hengst, Paul Höfer, Manfred Balzer, Ulrike Heckner, Erich Kittel, diverse Althistoriker, Adelhard Gerke, Heinz Meyer, Rudolf Suntrup, Ursula Großmann, Ulrich Wagener, Albrecht Kottmann, Thomas Küntzel, Hermann Weisweiler, Wolfgang Zwickel, Josef Schalkenbach, Stefan Wintermantel, Uwe Lobbedey, Rudolf Moosbrugger-Leu, Monika Fehse, Thomas Schilp, Heinrich Rüthing, Karl-Heinrich Krüger, Ralf Kirstan, Jörg Purner, Heinz Kaminski, Hermann Diekmann, Kurt Kibbert, Winfried Meschede, Michael Imhoff, Mircea Eliade, Menso Folkerts, Ulrich Karstedt, Heinz Probst, Christoph Albrecht, Sven Spiong, Herbert Stöwer, Hermann Veltmann, Horst Biere, O. Preuß, A. Falkmann u.v.a. mehr.
Und wenn man nun diese ganze „Gemengelage“ nur ordentlich verrührt, wird man feststellen, dass ein Bild daraus wird. Es sind zwar alles nur Indizien, leider keine Beweise. In der Juristerei kann man aber auch einen „Indizienprozess“ führen und gewinnen, selbst wenn Beweise letztlich fehlen. Und nicht mehr oder weniger kann diese Materialsammlung leisten. Nennen wir es ein „Indizienmosaik“. Ob es gelingt, das Geflecht der einzelnen Mosaiksteinchen so dicht und überzeugend zu schnüren, so dass eine Verurteilung bei einem „Mord ohne Leiche“ gelingt, wird sich am Ende zeigen. Kommen wir aber noch einmal auf Friedrich Hohenschwert, den Archäologen zurück. Hohenschwert grub ein Juwel aus, ohne zu ahnen, was er da genau fand. Das heutige Hinweisschild fragt: „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“? Und meint damit den abgebildeten Grundriss. „War es eine Kirche, ein Wohnhaus oder eine Scheune…? Wir wissen es –noch- nicht“. Im Grunde ein völlig irrationaler Gedanke, hier an einer so exponierten Stelle eine Scheune oder ein Wohnhaus zu vermuten. Die Antwort, die in diesem Skribt zu geben versucht wird, lautet: Wir haben hier die Stelle, an der Karl der Große seine Dankeskirche für seinen Sieg im Jahre 783 in Theotmalli errichtete. Desweiteren haben wir die Kirche, in der Papst Leo III im Jahre 799 einen Altar weihte, vor uns. Und: Wir haben die Erstgründung des Klosters Corvey „Hethis“ auf dem Tönsberg-Areal vor uns. Man kann noch weiter gehen, denn Bischof Meinwerk ließ 1023 (eher 1022) einen immensen Altarstein aus einer Kirche in Theotmalli abholen und in die Krypta der Abdinghofkirche in Paderborn bringen. Und auch dieser Vorgang spielte sich auf dem Tönsberg ab. Zur Zeit der Wallfahrten aus Dortmund (bis 1548) zum „Hulperberg“ muss diese Kirche bereits stark in Verfall geraten sein und die Hünenkapelle im Kernwerk wird das Ziel der Pilgerfahrten gewesen sein. Ja, das sind alles in allem schon anspruchsvolle Hypothesen und es wird sich zeigen, ob man den Schleier in Zukunft wird lüften können. Aber da, wo nur allgemeine Dunkelheit herrscht, wo es nur Unklarheiten gibt, da könnte ein schwacher Schimmer schon Licht bedeuten.Mag sein, dass Kritiker der Meinung sind, die Hohenschwert`schen Maßangaben (L x B) seien unsicher, oder die Wandstärke wäre z.B. nicht 0,80m, sondern nur 0,78m gewesen. Unentscheidend! Wichtig ist nur, wie es geplant wurde! Und zwar mit möglichst glatten Zahlen bei den Fuß-Maßen im Gesamtkonzept. Die Umsetzung der Soll-Maße in Ist-Maße, dazu in schwierigem Gelände ist eine Heraus- forderung, die ich selbst mit meinem Anspruch als Diplom-Ingenieur und trotz aller Bemühungen nicht leisten konnte. Man nehme als Beispiel ein DINA4-Blatt mit den definierten Maßen von 210mm x 297mm und lasse es von 10 verschiedenen Personen ausmessen. Es werden mindestens 8-9 unterschiedliche Ergebnisse präsentiert. Auch andere mögliche Faktoren, wie z.B. Erdbeben und deren Verwerfungen spielen dabei eine Rolle. Desweiteren gibt es im Skript eine Abhandlung zum Thema Bauungenauigkeiten. Da bleiben dann keine Fragen mehr offen. Die Kirche ist und bleibt ein mathematisches Kunstwerk! Hier kommt der Spruch von Jean Mignot (französischer Baumeister um 1400) in einer Bausitzung für den Mailänder Dom zur vollen Geltung: „Ars sine scientia nihil est“ (Kunst ohne Wissenschaft ist nichts)
Abschließend möchte ich zu dieser Materialzusammenstellung noch folgendes sagen: Ich habe alles über einen Zeitraum von ca. 5 Jahren immer nur nebenberuflich zusammen- gestellt. Auch hatte ich nicht die Zeit, alles schön zu sortieren bzw. Überleitungen von einem zum anderen Themengebiet zu schreiben, daher ist eine Art von Bilderbogen entstanden, der keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. Sicherlich mag die eine Skizze mehr zu überzeugen als die andere. Aber was auf jeden Fall bleibt, ist der Nachweis, dass hier nach der Zahlensymbolik des „Himmlischen Jerusalem“ gebaut wurde und sich gleichsam der „Tempel des Salomo“ hier wiederfindet. Meine Ansammlung von Textbausteinen soll insbesondere dem interessierten Leser nahegebracht werden. Selbst für eingefleischte Tönsberg-Kenner dürften auch noch einige Neuigkeiten dabei sein. Die lockere Präsentation und die vielen Abbildungen und Fotos sollen die manchmal doch etwas trockene Materie auflockern helfen. Mag sein, dass Kunsthistoriker oder Archäologen bei dieser unkonventionellen Darbietung wahrscheinlich die Nase rümpfen werden…..
Aber leider bringt uns das auch nicht weiter!So, und durch diesen ganzen Wirrwarr von Unterlagen und Meinungen werden wir versuchen uns einen gangbaren Weg zu bahnen und ihn am Ende unter neue
fruchtbare Gesichtspunkte stellen.
Als Ergebnis kann bereits jetzt festgehalten werden:
-Hethis/Hetha war auf dem Tönsberg
-Die Kirche(n) von 783 (772 ?) = Kirche 799 ebenfalls
-auf dem Tönsberg war eine alte, wichtige heidnische Kultstätte
-Unsere Kirche ist ½ mal so groß wie die in Corvey
-Der Hallenbau (Kirche) ist ein mathematisches Kunstwerk und ein Heiligtum an uralter Stelle
-Die Maße unserer Kirche entsprechen 1/10 des Tempel des Salomo
-Die Varusschlacht sollte sich in unmittelbarer Nähe zum Tönsberg abgespielt haben, jedoch nicht in Anlehnung an Cassius Dio
„Hethis“ war genauso wenig „aufm Sollinger Walde“ (Letzner), wie die Bremer Stadt-
musikanten in Bremen bzw. die Varusschlacht in Kalkriese.
Auf die Geschichte vom Sollinger Walde passt besonders gut das Zitat von Alfred Polgar (1873-1955), österreichischer Schriftsteller und Kritiker: „Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist“ Das bedeutet, man bleibt lieber bei dem Vertrauten und Bequemen, als umzudenken. Und wer sich jetzt immer noch krampfhaft bemüht, alles zu negieren, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Es ist eben nicht alles Schulwissen und Überlieferung, was sich in Wirklichkeit zugetragen hat!Damit sich der interessierte Leser auch mit eigenen geometrischen Ideen betätigen kann, ist am Anfang ein Blanko-Grundriss eingefügt, denn ich bin mir sicher, dass es bestimmt auch noch andere „Gesichter“ gibt, die man über die Gestalt dieser Fundament-Grundrisse legen kann. Trotz allem ist es bereits jetzt sicher, dass unser Tönsberg-Hallenbau sowohl mit Corvey, als auch mit Aachen zu tun hat. Die geometrische Beweisführung ist ziemlich erdrückend und selbst der größte Skeptiker wird zugeben müssen, dass der „Zuschnitt“ irgendetwas mit Mathematik zu tun haben muss. Wenn es also keine Scheune und kein Wohnhaus war, kann es nur noch eine Kirche gewesen sein. Allein das wäre ein Ergebnis! So, und welche Kirche ist in Lippe noch offen? Die Kirche Theotmalli 783 und die von 799 mit Papst Leo III Wir müssen keine zwei Kirchen mehr suchen. Es ist ein und dieselbe Kirche! Bestimmt haben sich im Skript irgendwelche Fehler eingeschlichen. Dafür bitte ich um Nachsicht. Aber sehr vieles ist auch richtig. Wer mag, darf meine Skizzen, Abbildungen und meine Fotos mit Angabe der Quelle sehr gerne weiterverwenden. Zum Abschluss dieses etwas umfangreichen Vorwortes möchte ich mich bei Karl-Heinz Hohmann aus Unna bedanken, der mir beim Abstecken der Kirche im Gelände eine große Hilfe war. Natürlich darf auch mein verstorbener Freund und Geomant Karl-Heinz Becker aus Iserlohn nicht unerwähnt bleiben, der mich einige Male auf den Tönsberg begleitete. Fehlen darf natürlich auch nicht Dr. Manfred Millhoff, dem ich es zu verdanken habe, überhaupt auf dem Tönsberg gelandet zu sein. In den 5 Jahren der Skript-Erstellung tauschte ich mich sehr regelmäßig auch mit meinem Freund Gerhard Steinborn aus Bremerberg/Marienmünster aus. Gerhard war es, der mich ständig ermutigte, diese Geschichte zu verfassen und nicht aufzugeben. Meinem Sohn Jannis Voigt aus Unna danke ich für seine Begleitung auf vielen Reisen zum Tönsberg und für seine tatkräftige Unterstützung bei vielen Vor-Ort-Recherchen.
Unna, im Juli 2025
Bernd Rehfuß
(C) Freundeskreis "Römerforschung im Weserbergland"!
Dieser Ausdruck wurde von der Internetseite http://www.roemerfreunde-weser.info gemacht.